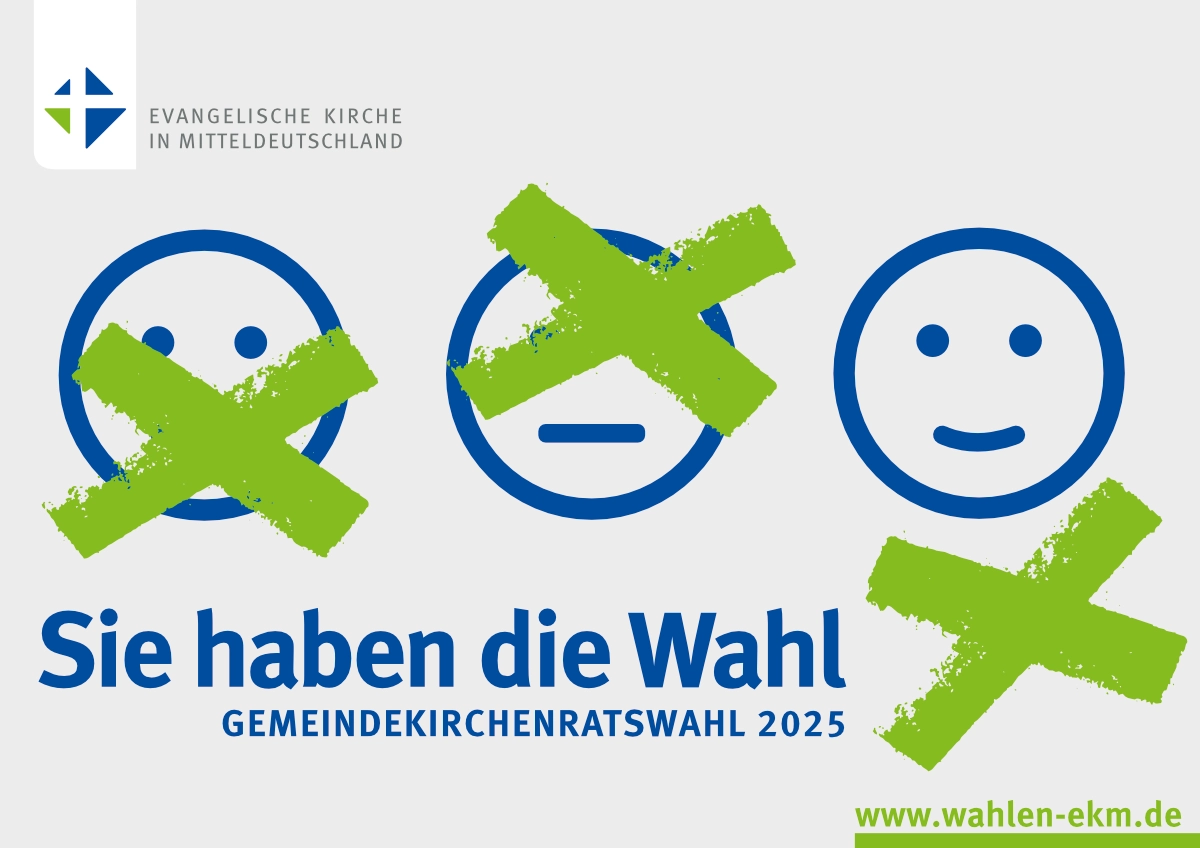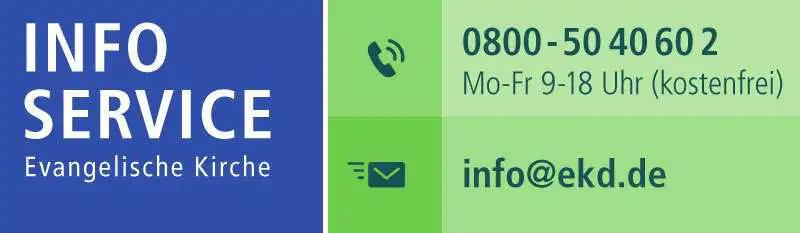Drei, vier, fünf Adventslieder kennen wohl die meisten Menschen. In unserem Adventskalender ist ein ganzer Schatz an Adventsliedern verborgen – jeden Tag ein neues Video. Gesungen werden sie von Friedrich Kramer. Der Landesbischof lädt zum Mitsingen ein, allein oder mit mehreren. Außerdem finden Sie hinter jedem Türchen Interessantes zu dem jeweiligen Lied …
Gern erinnern wir Sie jeden Tag daran, ein Türchen zu öffnen. Sie können hier die Erinnerungsmail abonnieren.
1. Dezember - Nun komm, der Heiden Heiland (Ev. Gesangbuch 4)
... könnte man als nahezu geografisch flächendeckendes Adventslied der heutigen EKM bezeichnen. Das Lied fand seine Erstveröffentlichung 1524 nämlich in Erfurt und in Wittenberg und galt jahrhundertelang als DAS lutherische Hauptlied der Adventszeit. Sein lateinisches Original, welches dem Bischof von Mailand Ambrosius zugeschrieben wird, muss Martin Luther derart in den Bann gezogen haben, dass dieser sich rätselhaft akribisch, fast wortwörtlich an dessen Übersetzung ins Deutsche hält. Für Luther sehr untypisch, für das Volk daher nur schwer zu verstehen.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/1438
2. Dezember - Mit dir, Maria, singen wir (Hohes und Tiefes 8)
... hat das Zeug, zu einem echten Klassiker der Ökumene zu werden. Und das natürlich nicht nur wegen seines schwungvollen und zum Mitsingen einladenden Rhythmus‘. Hört oder liest man den Titel, ist jedem eigentlich sofort klar: Das ist ein katholisches Liedgut. Wo taucht denn in „evangelischen“ Liedern Maria auf? Es gibt sie, doch sie sind eher rar gesät. Für den evangelischen Pfarrer Eugen Eckert zu rar. 1994 schrieb er zusammen mit dem Kirchenmusiker Winfried Offele den Text dieses ökumenischen Marienliedes. Über die sogenannte „Marienverehrung“ lässt sich sicherlich streiten, über die herausragende Stellung Marias für den gesamten Leib Christi jedoch nicht. Die Mutter Jesu soll allen Christen weltweit ein Vorbild im Glauben sein. Durch ihr vertrauensvolles JA zu Gottes Wegen ermutigt sie uns bis heute, auf Gott zu hören, mit ihm zu reden und seinen wunderbaren Plänen für unser Leben zu vertrauen.
3. Dezember - Macht hoch die Tür (EG 1)
.. schließt uns buchstäblich als erster Choral das Evangelische Gesangbuch auf. Im 17. Jahrhundert entstanden, ist es das Tor zu den Liedern des Kirchenjahres und erklingt überall in den Gemeinden zur Adventszeit, auch außerhalb Deutschlands. Lift up your heads, ye mighty gates heißt es beispielsweise im englischsprachigen Raum. Seine Übersetzerin Catherine Winkworth verhalf dem deutschen Choralgut auch darüber hinaus zu weltweiter Beachtung. 1854, 1858 und 1869 veröffentlichte die in Manchester aufgewachsene Winkworth ihre Sammlungen ausgewählter deutscher Kirchenlieder, die sie ins Englische übersetzt hatte. The Harvard University Hymn Book zufolge vollbrachte Winkworth „mehr als jede andere Einzelperson, um das reiche Erbe deutschen Kirchenliedgutes der englischsprachigen Welt zugänglich zu machen“. *Die Liebe zu den deutschen Chorälen entflammte übrigens während eines einjährigen Aufenthaltes in Dresden.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/321
4. Dezember - Wir messen mit knospenden Zweigen (Hohes und Tiefes 4)
... erklingt besonders in der katholischen und orthodoxen Kirche oft in Zusammenhang mit den Barbarazweigen. Scheinbar tote Zweige erwachen wieder zum Leben.
Barbarazweige sind Zweige von Obstbäumen, meist Kirsche oder Pflaume, die nach alter Tradition auch heute noch am 4. Dezember, dem Tag der Heiligen Barbara, geschnitten und in einer Vase ins Zimmer gestellt werden. Diese sollen am Heiligen Abend blühen und zum Christfest die Weihnachtsstube dekorieren. Eine Bauernregel besagt: „Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da.“ Je nach Region ist es zudem üblich, dass junge Mädchen jedem einzelnen Zweig den Namen eines Verehrers zuweisen. Der Zweig, der zuerst blüht, soll auf den zukünftigen Ehemann hinweisen. Wer’s glaubt...
5. Dezember - Oh Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7)
.. gehört zu den Standardliedern des Kirchenjahres und gilt als Meisterstück des katholischen Barockdichters Friedrich Spee, der von 1591 bis 1636 lebte. Das Aufgreifen von Gefühlsregungen war typisch für die barocke Instrumentalmusik, doch seinerzeit etwas ganz Neues in einem deutschen Kirchenlied. Bisher wurden fast ausschließlich Heilsereignisse in einer rein objektiven Art und Weise besungen, nun fand sich der Mensch selbst mit seinen Empfindungen darin wieder. Für unser heutiges Verständnis kaum wahrnehmbar, gelten die feinsten Nuancierungen zur Gefühlslage als bahnbrechend und revolutionär. Unter anderem spiegeln die vielen „Ohs“ und „Achs“ die starke Christus-Sehnsucht des Dichters wider.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/1441
6. Dezember - Der Bischof von Myra (Hohes und Tiefes 6)
..., dessen Vorname Nikolaus ist, zählt zu den bekanntesten Heiligen der Ostkirchen. Er wurde mit nur 19 Jahren in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts in Myra, im Gebiet der heutigen Türkei, zum Priester geweiht. Während der damaligen Christenverfolgung ging der Bischof durch Gefangenschaft und Folterung. Sein gesamtes Erbe verteilte Nikolaus an Bedürftige. Seitdem ranken sich unzählige Legenden um diesen Mann, die unter anderem hierzulande schließlich dazu führten, dass der Nikolaus am 6. Dezember kleine Geschenke in geputzte Stiefel steckt. Ursprünglich diente der Nikolaustag in vielen Ländern als Hauptbescherungs-tag für die Weihnachtsgeschenke. Doch infolge der Reformation und der damit verbundenen Ablehnung der Heiligenverehrung wurde die Bescherung vielerorts auf die Weihnachtsfeier-tage verlegt. Santa Claus ließ nicht lange auf sich warten, denn wer sollte denn nun an Weihnachten die Geschenke bringen, wenn der Niklaus es nicht mehr durfte?
Liedtext:
Der Bischof von Myra, die Stadt liegt am Meer, war gut den Menschen und half ihnen sehr.
Sein Name war Nik’laus, das ist wohl bekannt, bei Großen und Kleinen im ganzen Land.
Ein Freund der Kinder, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott.
Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen von Nikolaus.
Den Armen, den brachte er Gold ins Haus, gab wertvolle Schätze für Hungernde aus.
Und ging es den Kleinen und Schwachen mal schlecht, dann stand er zur Seite und sorgte für Recht.
Ein Freund der Kinder, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott.
Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen von Nikolaus.
Bald feiern wir Weihnacht, weil Jesus Christ als Kind für uns Menschen geboren ist.
Die Kleinen, die Schwachen, Gott ist ihnen nah. Und so war auch Nikolaus ganz für sie da.
Ein Freund der Kinder, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott.
Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen von Nikolaus.
(Text und Musik: Susanne Brandt-Köhn)
7. Dezember - Seht auf und erhebt eure Häupter (EG 21)
... gehört zu den Singsprüchen im Evangelischen Gesangbuch. Es handelt sich um einen Vers, der sich stets wiederholt und sich folglich tief ins menschliche Bewusstsein einprägt. Große Berühmtheit erlangte diese Form des Gebetes unter anderem durch die Gesänge des international ökumenischen Männerordens im französischen Taizé. Sie schaffen einen Raum, in der sich eine große Gruppe von Menschen vor Gott sammeln und gemeinsam beten kann. Die Gesänge aus Taizé werden heute in vielen Andachten und Gottesdiensten weltweit gesungen.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/9072
8. Dezember - Ihr lieben Christen, freut euch nun (EG 6)
... stammt von einem Schüler Martin Luthers, Erasmus Alberus. Seine scharfe Zunge, seine impulsive, direkte Ausdrucksart gepaart mit unglücklichen Umständen zwangen ihn - einer der leidenschaftlichsten Vertreter des Luthertums zu damaliger Zeit - zu einem Leben auf steter Wanderschaft, häufig durch das geographische Gebiet der EKM. Von Mainz nach Wittenberg, von Oberursel nach Eisenach, von Ost nach West und wieder zurück. Besonders hitzig ging es während seiner Anstellung im Hause des Grafen Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg im hessischen Babenhausen zu. Alberus und sein Dienstherr gerieten heftig aneinander, nachdem ersterer Kritik am Umgang des Grafen mit seiner Tante übte. Diese war Nonne des Klosters Marienborn, sollte jedoch aufgrund eines Fehltrittes bis zu ihrem Tod nahezu vollkommen isoliert auf Schloss Babenhausen leben. Die Kündigung und ein Prozess folgten. Alberus suchte und fand Zuflucht bei Luther und Melanchthon in Wittenberg.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/1519
9. Dezember - Gott, heilger Schöpfer aller Stern (EG 3)
.. liegt, wie bei vielen Chorälen im Evangelischen Gesangbuch, ein lateinischer Hymnus zugrunde. Conditor alme siderum - Allmächtiger Sternenschöpfer du heißt sein Original und geht bis in die Spätantike zurück. Ursprünglich war ein Hymnus als ein an Gott gerichteter feierlicher Preis- und Lobgesang gemeint. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden zahlreiche Ableitungen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Betonung. Eine uns sehr bekannte Form ist die Nationalhymne eines Staates. Wird eine Nationalhymne als ein Stück bestehend aus Text und Musik betrachtet, ist die seit dem 16. Jahrhundert gesungene niederländische Hymne wohl die älteste. Die deutsche Hymne besteht in seiner heutigen Form und Auswahl - der dritten Strophe des Liedes der Deutschen - erst seit 1991.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/9049
10. Dezember - Die Kerze brennt (Hohes und Tiefes 3)
..., ein kleines Licht, wir staunen und hören „Fürchte dich nicht“. So lautet der Refrain dieses kleinen Liedes mit der doch so großen Botschaft: Fürchte dich nicht. Wer sagt diese Worte zu uns? Wer fordert uns sogar dazu auf, keine Angst zu haben? Gott selbst gibt uns diese Anweisung, und das über 80 Mal in seinem Wort, der Bibel. Zählt man die sinngemäßen Formulierungen hinzu, sind es weit mehr. Egal wie die Umstände um uns herum aussehen mögen, welche bedrohlichen Erfahrungen wir bereits gemacht haben oder wie stark uns die Ungewissheit der Zukunft lähmen will, Gott ist immer größer. Er sitzt im Regiment und spricht einem jeden Menschen zu: Fürchte dich nicht!
11. Dezember - Er ist die rechte Freudensonn (EG 2)
... ist gewissermaßen die Kanon-Version des dritten Kalendertürchens - ein sehr populärer Gesang, der von vielen Chören nicht nur zur Adventszeit gesungen wird. Melodisch ins Leben gerufen hat ihn 1955 der deutsche Komponist und Chorleiter Paul Ernst Ruppel. Seit frühester Kindheit stand sein Berufswunsch fest: Kirchenmusiker. Umso schmerzhafter musste es für ihn gewesen sein, als Ruppel nach wenigen Jahren im Beruf zu Beginn des Zweiten Weltkrieges eingezogen wurde. Seine Leidenschaft für die Musik sollte, zumindest praktisch, für viele Jahre ruhen. Zunächst führte ihn der Krieg in die Niederlande, dann nach Belgien und Sizilien. Aufgrund einer Kriegsverletzung arbeitete der Musiker zwei Jahre in einer Käserei, bis ihn die Wehrmacht erneut einzog und er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. USA, Schottland und England hießen die nächsten Stationen. Doch ein erlösender „Zufall“ brachte ihm die persönliche Wende. Die Kirchengemeinde in Südengland suchte einen Orgelspieler, und Ruppel durfte seine Berufung wieder aufnehmen. Nach Kriegsende wieder in der Heimat, schuf er einen wahren Schatz für die deutsche Kirchenmusik.
12. Dezember - „Tröstet, tröstet“, spricht der Herr (EG 15)
... ist ein klarer Aufruf. Wir sind aufgerufen, einander zu trösten – jeder in seiner Art und Weise, jeder an seinem Platz. 1938 von einer Adventspredigt stark inspiriert, verfasste der Hamburger Pastor Waldemar Rode den Text dieses Liedes, der sich auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja bezieht. Gott spricht hier seinem geliebten Volk Israel Trostworte zu. Trostworte, die heute noch gelten – für Israel und die ganze Welt. Wie von einigen Theologen bestätigt, dient der Choral heutzutage häufig als Einleitung oder Nachklang geistlicher Gespräche.
13. Dezember - Wie soll ich dich empfangen (EG 11)
... und wie begegn ich dir? Der bereits im Jahre 1653 von Paul Gerhardt verfasste Text soll uns auch heute noch dazu aufrufen, dieser Frage ganz persönlich nachzugehen. Wie begegne ich Gott im Alltag oder wie begegnet ER mir? Wo kann ich Gott und sein Handeln in meinem Leben ganz konkret sehen? Suche ich IHN, wenn ich in Schwierigkeiten stecke und nicht weiter weiß? Bringe ich IHM meinen Dank zum Ausdruck über das, was mich erfreut? Beziehe ich IHN in meine Pläne ein und frage IHN, was ER dazu sagt? Gott ist uns längst begegnet und tut es bis heute in Jesus Christus. ER wartet auf uns.
14. Dezember - Seht, die gute Zeit ist nah (EG 18)
... ist in seinem Original wahrscheinlich ein Zungenbrecher für alle, die der Slawischen Sprachen nicht mächtig sind. Svatou dobu již tu máme ist mährisch und diente dem evangelischen Pfarrer und Kirchenliederdichter Friedrich Walz 1972 als Vorlage des uns bekannten Adventsliedes. Der Mährischen Sprache gehören vielerlei Dialekte des Tschechischen an, die überwiegend im östlichen Teil der tschechischen Republik von den Mähren gesprochen werden. Darunter mährisch-hanakisch, mährisch-slowakisch oder mährisch-schlesisch, um die drei übergeordneten Dialektgruppen zu nennen. Die heute etwa 630.000 Mähren bezeichnen sich als eigene Volksgruppe mit tschechischer Staatsangehörigkeit.
15. Dezember - Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10)
... wurde im 17. Jahrhundert von dem Theologen und Kirchenliederdichter Valentin Thilo verfasst. Der Choral-Mittelpunkt soll das Herz eines jeden Menschen bilden, das sich auf Gott ausrichten darf und soll. Das Herz ist ein Bild für zwischenmenschliche Beziehungen, für das menschliche Gewissen, für den Kern der Persönlichkeit, für die Ganzheit der Persönlichkeit, für die Tiefe menschlicher Empfindungen.* Wenn die Bibel vom Herzen spricht, kann man sich sicher sein: Hier geht es um alles, um Leben und Tod, um die Identität des Menschen, um Grundlegendes, um nichts zu Vernachlässigendes. Blicken wir mit demütigendem Herzen auf Gott, haben wir das Wichtigste im Leben erkannt.
16. Dezember - Es kommt ein Schiff geladen (EG 8)
... ist einer der ältesten geistlichen Gesänge in deutscher Sprache. Er wurde um 1626 von Daniel Sudermann, einem Schriftsteller und Pfarrer, „relaunched“, damals mit folgenden Worten angekündigt: „Ein Vraltes Gesang, etwas verständlicher gemacht. Habs abg. und zurecht gebracht.“ Diese Fassung finden wir heute im Evangelischen Gesangbuch. Die ursprüngliche marianische Gestalt des Stückes aus Straßburg lässt sich nur sehr vage rekonstruieren. Die Bildhaftigkeit ist dafür umso reicher und für unterschiedliche Interpretationen offen. Wen oder was beschreibt das eindrucksvolle Schiff in der ersten Strophe? Es könnte Maria sein, die Kirche oder die menschliche Seele. Zudem kommt die uralte Bedeutung des Schiffes als Sinnbild für das Aufeinandertreffen verschiedener Dimensionen: für die Begegnung zwischen Meer und Land, von Himmel und Erde, von Gott und Mensch.
(Gerhard Hahn und Jürgen Henkys (Hrsg.): Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch. Heft 5. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2007)
17. Dezember - Gottes Lob wandert (HuT 5)
... auch durch uns in die Welt, ganz praktisch durch unsere Lieder. „Scharen von Schwestern und Brüdern im Glauben singen“ heißt es in der zweiten Strophe. Singen gehört zu einer Grundform menschlicher Kommunikation. Und mehr noch: Singen ist absolut gesund für Leib und Seele. Es ist so wirksam wie leichter Sport, der Kreislauf kommt in Schwung. Durch das Singen werden die Abwehrkräfte gestärkt und Erkältungskrankheiten vorgebeugt. Singen tut außerdem unserer Seele gut. Stimmungsaufhellende Hormone werden freigesetzt, Stresshormone dagegen abgebaut. Und wenn wir dann nicht nur die Jingles in der Werbung mitträllern, sondern Hoffnung und Liebe in Gott musikalisch verkünden, ist das ein ganz wesentlicher Beitrag für die Menschen in der oft so düsteren Welt - ein Dienst, der durch nichts ersetzt werden kann. Landesbischof Friedrich Kramer macht es uns vor. Singen Sie mit!
18. Dezember - Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16)
... ist 1938 geschrieben worden von Jochen Klepper. Seine Liedform ist in nahezu allen gängigen Liederbüchern der Kirche zu finden, ist überkonfessionell und stark verankert. Und das, obwohl es nicht gerade zum Mitschunkeln einlädt und harmonische Emotionen in uns weckt. Doch vielleicht gerade deswegen. Wegen seiner Tiefe, wegen seiner Schwere, wegen seiner Wahrheiten. Der deutsche Theologe Jochen Klepper, verheiratet mit einer jüdischen Frau, litt unsagbar unter der Tyrannei der deutschen Nationalsozialisten. Kurz vor dessen Deportation in die Konzentrationslager sah die Familie keinen anderen Ausweg als den Freitod. Die Nacht ist vorgedrungen... Das Familiengrab befindet sich auf dem Berliner Friedhof Nikolassee. Klepper gilt als einer der bedeutendsten Dichter geistlicher Lieder des 20. Jahrhunderts. Trotz der grausamen Umstände hielt er an Gott fest. Seine Texte spenden wahre Hoffnung, denn nach dem Leid kommt die Erlösung, nach dem Dunkel das Licht.
19. Dezember - O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19)
... gibt uns eine klare Perspektive für unser Leben. Eine Perspektive, an der wir unser Leben ausrichten und uns orientieren können: Jesus Christus, das Licht der Welt. Um dieses Licht nicht aus dem Blick zu verlieren, wurden die meisten Kirchen hierzulande gen Osten hin errichtet. Der Himmelsrichtung, in der die Sonne aufgeht und aus der die ersten Lichtstrahlen des neuen Tages durchbrechen. Dort steht der Altar, dorthin blicken die Gläubigen. O komm, o komm, du Morgenstern geht auf eine uralte lateinische Antiphon, einen Wechselgesang, zurück und wurde zu Beginn des 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt. Wegen seines Bekenntnisses zu Israel und dem jüdischen Volk stand der Choral während der Herrschaft der Nationalsozialisten auf der „Schwarzen Liste“.
20. Dezember - Tragt in die Welt nun ein Licht (HuT 1)
... können Sie in unserem Gesangbuch der EKM nicht finden, wohl aber in den Ausgaben der Kirchen von Rheinland, Westfalen und Lippe, Niedersachsen und Bremen, Nordelbische Kirche und Hessen. Wolfgang Longardt schrieb dieses Lied 1972 eigens für einen Adventsgottesdienst mit einer Lichterprozession für Kinder. Ist Ihnen während des Anstimmens etwas aufgefallen? Damit sich die Melodie leicht einprägen lässt, hat sich Longardt für den ersten Teil einer sehr bekannten Tonfolge bedient. Erkennen Sie es?
21. Dezember - Tochter Zion (EG 13)
... ist ein ganz klassisches Adventslied. Jedenfalls für uns, die wir aus dem deutschsprachigen Raum kommen. In den Niederlanden, in Frankreich, Teilen der Schweiz und Skandinaviens hört man die majestätisch anmutende Melodie von Georg Friedrich Händel nicht zur Weihnachtszeit, sondern zu Ostern. Die französische Version trägt den Titel À toi la gloire, O Ressuscité! (dt.: Dir sei Ruhm, oh Auferstandener!) Doch auch der deutsche Text wäre zur Osterzeit nicht fehl am Platz, zog doch Jesus unter Freudenrufen vieler Menschen während des Passafestes in Jerusalem – in Tochter Zion – ein. Übrigens, in den meisten Kombinationen von Musik und Text existiert Letzteres eher. Tochter Zion liefert uns ein Gegenbeispiel. Der deutsche Theologe Friedrich Heinrich Ranke verfasste den Text des heutigen Adventsliedes 1820, da war der musikalische Jubelruf Händels bereits 80 Jahre alt.
22. Dezember - Nun jauchzet, all ihr Frommen (EG 9)
... sprach in der ersten Zeile des Chorals ursprünglich eine andere Gesellschaftsebene, nämlich die der damals Mächtigen, an. Mit „Nun jauchzet, all ihr Potentanten“ ermahnte der Berliner Kirchenliederdichter und Pädagoge Michael Schirmer die Leute, die durch ihre aufgeblasene Selbstherrlichkeit ihren Mitmenschen und dem ganzen Volk keine guten Vorbilder waren. Ein Text, der an entsprechender Stelle heute vielleicht genauso seine Berechtigung finden würde? Schirmer und seine Zeitgenossen erlebten den Schrecken des 30jährigen Krieges hautnah mit und wussten um die Gefahr, die von Machtbesessenen und Unterdrückern ausgeht.
Den Liedtext finden Sie hier: www.liederdatenbank.de/song/1444
23. Dezember - Der grüne Zweig
... muss nicht ausschließlich Teil eines Tannenbaums sein, den wir vielleicht in dieser Jahreszeit sofort vor Augen haben. Der Baum bzw. der grüne Zweig mit seinen immer wieder neu wachsenden Blättern ist per se ein Symbol für das wiederkehrende Leben - in unserem eigenen Herzen, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Peter Janssen, der diesen Kanon zusammen mit dem katholischen Priester Wilhelm Willms 1993 geschrieben und komponiert hat, gehört zu den Initiatoren des Sacro-Pop und hat so die zuweilen „eingestaubte“ Kirchenmusik - zumindest in den Ohren der jüngeren Generation - wiederbelebt. Wenn Sie sich jetzt fragen: Wie hört sich denn Sacro-Pop so an; dann hören Sie mal in die Taizé-Gesänge rein, oder rufen Sie sich die etwas rockigen Lobpreislieder in Jugendgottesdiensten und die oft mit Bewegungen kombinierten Kinderlieder in Familiengottesdiensten in Erinnerung. Das ist „Heilige Popmusik“.
24. Dezember - O du fröhliche (EG 44)
... wurde in seinen Ursprüngen nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit gesungen, sondern machte als sogenanntes „Allerdreifeiertagslied“ ganzjährig musikalisch Freude. So hieß es in Strophe eins und zwei eben: ... gnadenbringende Osterzeit! Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden. Und ... gnadenbringende Pfingstenzeit! Christ, unser Meister, heiligt die Geister. Versuchen Sie doch mal, den alten Text mit der Ihnen bekannten Melodie zu singen. Es klappt tatsächlich. Gedichtet wurden die Verse 1815 von Johannes Daniel Falk, dem Gründer des Weimarer „Rettungshaus für verwahrloste Kinder“, für genau diese. Mit seinem pädagogischen Konzept richtete er sich an die oft durch Armut und Elternlosigkeit auf die schiefe Bahn geratenen Kinder und Jugendlichen, schenkte ihnen ein neues Zuhause und individuelle Förderung. Nach diesem Vorbild entstanden zahlreiche „Rettungshäuser“ in Deutschland. Sie sind eng mit der Geschichte der gegenwärtigen Diakonie und sozialen Arbeit verbunden.
P.S.: Die uns heute bekannte zweite und dritte Weihnachtsstrophe verfasste der Kirchenliederdichter Heinrich Holzschuher. Für die Melodie behalf sich Falk eines sizilianischen Marienliedes.
TAGESLOSUNG - 26.04.2025
Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben.
Prediger 5,9
Wir haben nichts in die Welt gebracht; darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen.
1. Timotheus 6,7-8