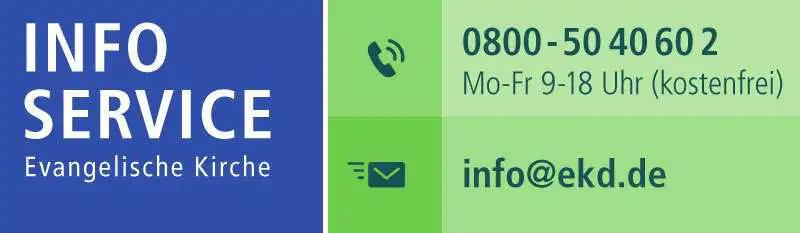30.10.2019
Axel Noack: "Wir müssen wieder
Friedensgruppen gründen"
Im Interview erinnert der frühere Magdeburger Bischof Axel Noack an die zentrale Rolle der Kirchen bei der friedlichen Revolution
chrismon: 1989 waren Sie Pfarrer in Bitterfeld-Wolfen, mitten im Chemiedreieck der DDR. Im Oktober haben Sie in Ihrer Kirche öffentliche Friedensgebete organisiert. Wer hat da mitgemacht?
Axel Noack: Viele Gemeindemitglieder, viele Nachbarn, aber auch viele, die wir nicht kannten. Der Gottesdienst bot auch einen gewissen Schutz für die Teilnehmenden. Das Gebet hat vielen geholfen, sich zu trauen, etwas zu sagen. Sie traten mit zitternder Stimme nach vorne und sagten, was sie als Ärgernis im Land empfanden und was sich ändern sollte. Manche hatten auch ihren Beitrag vorher aufgeschrieben. Ich habe einige Zettel mit Notizen aufgehoben. Zum Beispiel sagte eine Mutter von zwei Kindern, die in einem Chemiebetrieb arbeitete: "Voraussetzung für Veränderungen ist der offene Gedankenaustausch zwischen allen Bürgern, unabhängig von ihrer Weltanschauung." Sie forderte Meinungsvielfalt und dass die Privilegien von Funktionären abgeschafft werden.
Sie haben das Pfarrhaus auch für NVA-Soldaten geöffnet. War das nicht ein Widerspruch zu Ihrem Engagement für den Frieden?
Ich bin als Pazifist zwar gegen Kriegseinsätze. Aber als Seelsorger habe ich mich selbstverständlich auch um die Soldaten gekümmert. In Wolfen war eine große Kaserne, weil viele Soldaten in der Chemieproduktion eingesetzt wurden. Im Oktober 1989 hatten viele Angst, dass sie mit einem Schießbefehl zu den Montagsdemonstrationen nach Leipzig geschickt würden.
Was haben Sie ihnen geraten?
Ich habe erst mal zugehört und dann gesagt: Du musst selbst herausfinden, was du für richtig hältst, und dich dann prüfen, was du davon verwirklichen kannst. Das ist ja in allen Lebensbereichen so: dass man weiß, was richtig ist, und trotzdem etwas anderes tut. Wenn man sich ehrlich eingesteht, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann wird man auf einmal mutiger und traut sich mehr zu. Meistens ist es aber so, dass sich die Leute die Wirklichkeit schönreden. Wenn sich zum Beispiel Pfarrerinnen oder Pfarrer scheiden lassen, sind sie auf einmal die größten Verteidiger von Scheidungen, anstatt ehrlich zu sagen: Ich finde die Ehe richtig, aber ich hab’s leider nicht geschafft.
Sie selbst haben den Wehrdienst verweigert und durften deshalb nicht Mathematik studieren. Woher nahmen Sie den Mut?
Das war 1968! In der Oberschule in der Christen lehre, die wir liebevoll "Club" nannten, haben wir Gandhi und Martin Luther King gelesen, gewaltloser Widerstand spielte eine große Rolle. Das hat meine pazifistische Haltung geprägt. Da wäre man sich ja schäbig vorgekommen, wenn man zur NVA gegangen wäre. Ich habe aber unter den Folgen nicht wirklich gelitten wie andere. Im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist. Ich kannte einen Diakon, der in den Alten- und Behinderteneinrichtungen in Lobetal bei Berlin gearbeitet hat. Nachdem ich nicht Mathematik studieren durfte, habe ich erst mal dort ein Jahr lang behinderte Menschen begleitet und eine ganz andere Perspektive aufs Leben bekommen. Danach habe ich Theologie studiert.
Die Pfarrerinnen und Pfarrer mussten die Friedensgebete 1989 nicht erfinden. Die evangelische Kirche in der DDR hatte seit den 80er Jahren den Frieden zu ihrem zentralen Thema gemacht. Warum?
Das war eine Reaktion auf die Einführung des Wehrkundeunterrichts in den neunten Klassen 1978. Die Kirche hat die Erziehung zum Frieden dagegengesetzt. Die anderen Bürgerrechtsfragen nach Demokratie, Wahlrecht und Umwelt entwickelten sich drumherum. Sich für den Frieden zu engagieren, lässt sich biblisch gut begründen, mit dem Wahlrecht und der Demokratie geht das nicht so einfach. Es ist schade, dass sich viele Friedensgruppen nach der Wende aufgelöst haben. Heute fehlen sie.
Haben die kirchlichen Friedensgruppen in die Gesellschaft ausgestrahlt?
Die regionalen Kirchentage zu Luthers 500. Geburtstag 1983 waren eine große Hilfe, da haben sich die Gruppen vernetzt – auch in andere alternative Szenen hinein bis hin zu den Punks. Danach gab es alle zwei Jahre große Treffen unter dem Motto "Konkret für den Frieden". Diese Vernetzung bis in die Punkerszene war unter den Konservativen in der Kirche umstritten. Menschen am Rande der Gesellschaft hat man zwar betreut, aber sie waren eigentlich mehr die Objekte unseres diakonischen Handelns. Der damalige Erfurter Propst Heino Falcke sagte: Gerade in diesen Menschen zeigt sich Jesus Christus. In der Kirche waren die Randgruppen geschützt, die Polizei hat meistens weggeschaut nach dem Motto: Hauptsache, es dringen keine revolutionären Gedanken nach draußen. Es drang aber eben doch was nach draußen.
Haben die Friedensgruppen dadurch die Revolution 1989 mit aus der Taufe gehoben, wie oft behauptet wird?
Die Revolution wäre sicherlich auch ohne die Kirche gekommen. Aber die Kirche und ihr jahrelanges Engagement für den Frieden haben wesentlich dazu beigetragen, dass sie friedlich blieb.
1989 waren Pfarrerinnen und Pfarrer gefragt wie selten. Warum?
Sie genossen einen sehr großen Vertrauensvorschuss, weil sie sich ihre Unabhängigkeit von der SED bewahrt hatten. Da ahnte niemand, dass etliche Pfarrer für die Stasi gearbeitet hatten. Außerdem hatten die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer durch die Kirchenparlamente Erfahrung mit demokratischen Prozessen und konnten gut zwischen unterschiedlichen Positionen vermitteln.
Das Interesse vieler Menschen an der Kirche und an den Friedensgruppen hat nach dem Mauerfall schnell nachgelassen. Waren Sie enttäuscht darüber?
Viele in der Kirche standen wie ich der Bürgerbewegung nahe und waren relativ schnell frustriert, weil sie den Eindruck hatten, die Masse der Bevölkerung will schnell die D-Mark und keine Reform der DDR. Bei der Wahl 1990 zeigte sich das ja auch. Aber so sind die Menschen eben, sie sind keine Heiligen.
Wie haben Sie die ersten Treffen mit Bischöfen und Pfarrern aus dem Westen erlebt?
Die Unterschiede waren viel größer, als wir das in den Jahren zuvor wahrgenommen hatten. Als wir uns im Januar 1990 trafen, sagten die Westkollegen: "Freut euch, ihr habt’s hinter euch!" Und ich sagte: "Nein, das war doch unser Leben!" Das zusammenzukriegen war nicht leicht. Viele hatten Angst, dass von der Ostkirche nichts bleibt und alles nach der Melodie der EKD geht, der Westkirche. Wir hatten den Eindruck, jetzt sind wir zwar frei, aber nicht frei, unsere Positionen zu bestimmen.
Was waren die strittigen Punkte?
Alles, was das Verhältnis von Staat und Kirche betrifft: staatlich finanzierte Soldatenseelsorge, Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, Kirchensteuer. Viele von uns wollten, dass die Kirche unabhängig vom Staat bleibt und die Soldatenseelsorge selbst finanziert. Ein Pfarrer muss die Freiheit haben, zur Not auch Wehrkraftzersetzung zu betreiben. Die Kollegen im Westen waren mächtig aufgeregt, dass sich womöglich unsere ostdeutsche Sicht durchsetzen könnte. Sie wollten, dass es bei der staatlich finanzierten Militärseelsorge bleibt.
Strittig war auch die Kirchensteuer.
In der DDR hatten wir keine echte Kirchensteuer. Im Grunde lebten wir von dem, was die Gemeindeglieder in die Kirche trugen. Unsere westlichen Partner haben uns auch sehr unterstützt. Heute freuen wir uns im Osten über die Kirchensteuer. Dankbar sind wir auch für den kircheninternen Finanzausgleich. Aber wir sind bis heute nicht so abhängig von der Kirchensteuer wie die Kollegen im Westen. Wir leben immer noch ziemlich stark von den Kollekten und vom Kirchgeld, weil die Leute im Osten noch gewohnt sind, dass man das Geld in die Kirchen bringen muss. Beim Religionsunterricht waren es vor allem die christlich engagierten Eltern, die dagegen waren, den Unterricht an staatliche Schulen zu bringen. Viele hatten bittere Erfahrungen in den Schulen gemacht.
Es ging aber doch recht schnell mit der Wiedervereinigung der Kirchen. Im Juli 1991 war es so weit. Hat die Kirche für viele Ostdeutsche dadurch Glaubwürdigkeit verloren?
Es gab bestimmt einige, die sich in der wieder- vereinigten Kirche nicht mehr zu Hause fühlten. Aber die Masse der Leute wollte die kirchliche Wiedervereinigung. Wir hatten auch Angst, dass uns die Kirche im Osten auseinanderbricht. Es gab Kirchengebiete, die durch die Mauer zerschnitten worden waren. Schmalkalden zum Beispiel gehörte vor 1961 zur hessischen Kirche und lag danach in der DDR. 1989 hat es keine zwei Tage gedauert, und die wollten wieder zurück in den Westen. Doch die Kirchengebiete, die vor 1961 im Osten lagen und danach westlich geworden waren, wollten nicht in den Osten zurück. Ich habe damals gesagt: Manchmal knistert der Heilige Geist wie ein 1000-Mark-Schein. Man darf es nicht übertreiben mit dem Heroismus der Kirche in der DDR.
Wie sehen Sie die Wiedervereinigung der Kirchen heute?
Wie bei der politischen Wiedervereinigung hätte manches viel länger gebraucht, etwa die Frage, was mit kirchlichen Abschlüssen passiert. In der DDR gab es viele kirchliche Ausbildungsstätten und Abschlüsse, die nicht staatlich anerkannt waren. Es waren schwierige Verhandlungen, bis das zusammenpasste, aber es ist doch ganz gut gelungen.
Haben Sie sich mit der staatlich finanzierten Militärseelsorge angefreundet?
Das war ein langer Prozess. Es hat mich zum Beispiel auch sehr gestört, dass Pfarrer zwingend Bundesbeamte werden mussten, um Militärseelsorger zu sein. Das haben wir zum Glück geändert. Es werden zwar immer noch fast alle Bundesbeamte, aber das ist für die Kirchen freiwillig und natürlich finanziell attraktiv. Die Qualität der Seelsorger hat sich durch die Auslandseinsätze sehr verbessert, auch der Militärbischof heute versteht sein Amt deutlich anders und prägt es viel kirchlicher. Früher war so mancher Militärdekan nahezu ein verhinderter General. Heute sind viele Generäle viel skeptischer, was die Einsätze angeht, als die Politik. Die Generäle haben zum Beispiel von Anfang an gefragt, was denn das Ziel in Afghanistan sein soll? Es müssen ja auch nicht alle Pazifisten sein wie ich. Aber es muss Pazifisten geben, als Korrekturinstanz, sonst läuft etwas schief.
In Zukunft werden deutlich weniger Menschen Mitglied in der Kirche sein. Kann die Kirche von der DDR-Kirche lernen, Minderheit in der Gesellschaft zu sein?
Na ja, wir hatten das Minderheitensein zu sehr verinnerlicht. Es hat lange gedauert, bis wir aus der Nische gekommen sind. Die Protestanten in Frankreich sind auch eine Minderheit, aber öffentlich sehr präsent. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Die Kirche hat viel zu sagen, auch wenn es nur noch drei Mitglieder gibt! Und wir beten für alle.
Was müsste sich in der Kirche ändern?
Wir sind zu sehr auf die Kirchenmitgliedszahlen fixiert. Hier im Osten machen so viele Menschen bei den Kirchen mit, die keine Mitglieder sind. Das ist doch toll! Natürlich müssen wir auch überlegen, wie die sich finanziell beteiligen können. Aber wichtiger ist, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer Anteil nehmen an dem, was den Menschen passiert. Und zwar ohne Hintergedanken und ohne sie zu belehren. So wirkt die Kirche glaubwürdig und gewinnt das Vertrauen der Menschen zurück.
Das zentrale Abkommen zur Rüstungskontrolle wurde kürzlich aufgekündigt, autoritäres Denken wird populär. Muss die Kirche die Friedensarbeit wieder ins Zentrum stellen?
Unbedingt! Es ist erschreckend zu beobachten, wie die Instrumente der Friedenssicherung unter die Räder kommen. Mich schockiert, dass keiner mehr davon redet, dass es UN-Mandate braucht für Auslandseinsätze. Heute hustet Trump, und sofort überlegen die Deutschen, ob sie mitmachen. Doch wenn sich die UN nicht einig sind, kann man nicht in einen Einsatz gehen. Wir müssen die Gewalt ans Recht binden. Das ist eine zentrale Errungenschaft der Demokratie! Das müssen wir als Kirche viel deutlicher zur Sprache bringen. Wir müssen auch wieder Friedensgruppen gründen. Und die, die es schon gibt, müssen sich vernetzen.
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland will auf ihrer Tagung im November den Frieden zum Schwerpunkt machen.
Das ist ein guter Anfang. Frieden hat ja auch viele Aspekte. Das fängt bei feindseliger Rhetorik an, die hatten wir in der DDR, und wir haben sie heute. Die Kirche könnte Vorbild sein und sich selbst verpflichten und dazu aufrufen, besonders behutsam mit der Sprache umzugehen. Manche haben den Eindruck, dass auch unter uns in der Kirche der Ton rauer geworden ist, zum Beispiel in den Leserbriefen unserer Kirchenzeitungen.