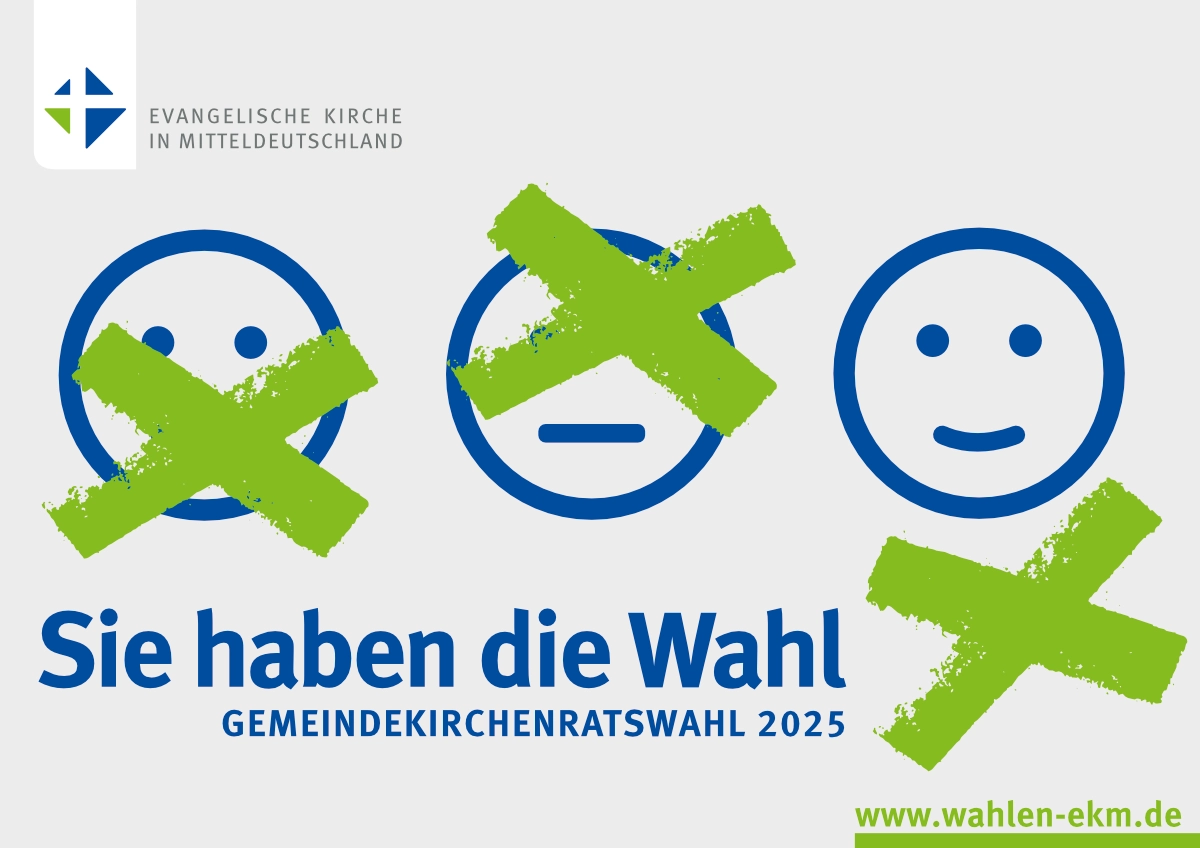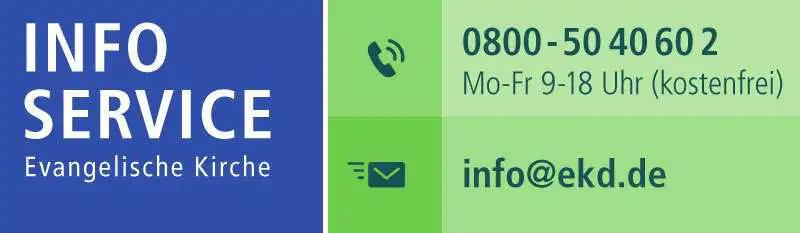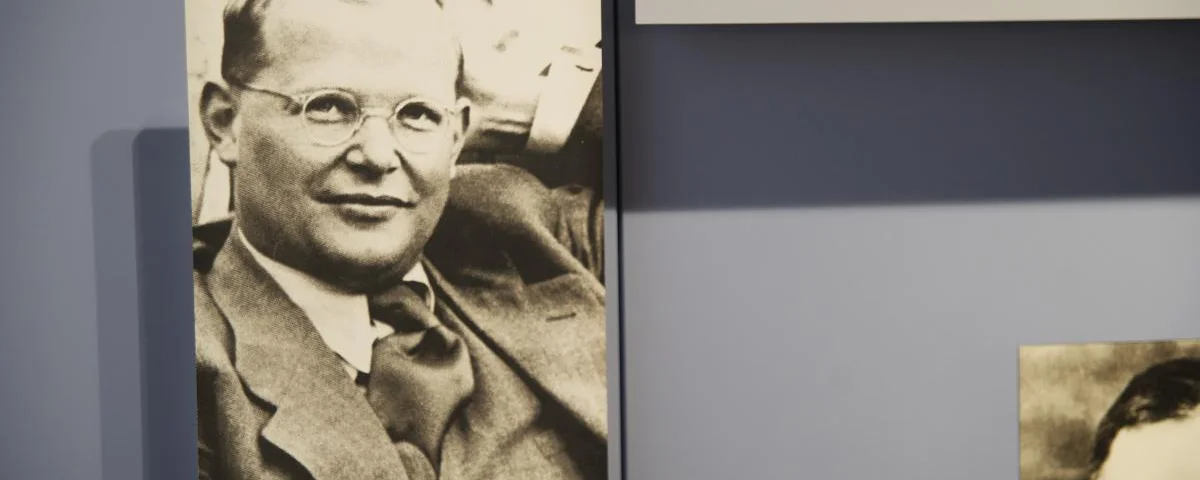
04.04.2025
Mut gegen Tyrannei: Dietrich Bonhoeffer wurde 1945 von den Nazis hingerichtet
Berlin (epd). Die Sonne geht auf im Morgengrauen, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreitet durch ein Spalier zu seiner Hinrichtungsstätte, einem Galgen im Konzentrationslager Flossenbürg.
So jedenfalls zeigt es das amerikanisch-irische Biopic, das vor dem 80. Todestag Bonhoeffers am 9. April in die deutschen Kinos gekommen ist. In Wirklichkeit dürfte der Theologe und Widerstandskämpfer durch die SS-Schergen kurz vor der Hinrichtung gedemütigt worden sein. Augenzeugen berichteten später, er sei nackt gehängt worden.
Das US-amerikanische Filmplakat zeigte den evangelischen Pfarrer gar mit einer Waffe in der Hand - eine Falschdarstellung. Zwar gehörte Bonhoeffer zu den Verschwörern, die NS-Diktator Adolf Hitler töten wollten, doch war er selbst kein Attentäter. Diese Darstellung passt aber in das Bild Bonhoeffers, das gerade unter der christlich-nationalistischen Rechten in den USA verbreitet ist. Darin wird der Widerstand des Theologen gegen die Nationalsozialisten als Widerstand gegen angeblich falsche staatliche Autorität instrumentalisiert.
Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen November warnten US-amerikanische und deutsche Theologen vor einer historisch falschen Gleichsetzung von Gegenwart und NS-Regime. Der Berliner Theologe und Sozialethiker Wolfgang Huber hat den offenen Brief damals mit unterzeichnet. „Bei allem großen Respekt, den Bonhoeffer verdient, muss man doch aufpassen, dass man ihn nicht heroisiert oder gar instrumentalisiert“, sagt Huber. Bonhoeffer habe sich selbst als viel normaler angesehen, als er heute dargestellt werde. Er habe auch nie ein Märtyrer sein wollen.
1906 in Breslau geboren, entwickelt sich Bonhoeffer mit Anfang 20 zum theologischen Überflieger. Er kritisiert das totalitäre NS-Regime von Anfang an für dessen Rassenpolitik, wird Mitglied der Bekennenden Kirche, die sich gegen die Hitler-treuen Deutschen Christen wendet. Er schreibt schon 1933 einen Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“. Darin fordert er aktiven Widerstand gegen staatliches Unrecht. 1935 wird er mit einem Rede- und Lehrverbot belegt.
Die Chance zur Emigration besteht 1939: Schon in den USA angekommen, entscheidet er sich schließlich gegen eine Pfarrstelle in New York und reist zurück nach Deutschland, wo er seinen Platz sieht. Zwar sei Bonhoeffer das Risiko durch die Repressionen des NS-Staates bewusst gewesen, sagt der Historiker und Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, Johannes Tuchel. Aber dieses habe er in der tödlichen Konsequenz 1939 noch nicht abschätzen können.
Während des Kriegs bis zu seiner Verhaftung 1943 arbeitet Bonhoeffer für den militärischen Auslandsgeheimdienst im Oberkommando der Wehrmacht. Das schützt ihn vor dem Militärdienst an der Front. Er wird Teil des Widerstandsnetzwerks. Von Planungen für einen Umsturzversuch gegen Hitler hat Bonhoeffer mutmaßlich bereits 1939 von seinem Schwager Hans von Dohnanyi erfahren, der Bonhoeffer ins Amt Ausland/Abwehr holt. Wie seine eigene Rolle dabei aussehen sollte, habe Bonhoeffer damals eher nicht gewusst, sagt Tuchel.
Die Verschwörer im Amt Ausland/Abwehr versuchen, in den Jahren 1941 und 1942 über Bonhoeffer Kontakte zu Kirchenleitungen in Skandinavien und in Großbritannien zu knüpfen, um Gesprächskanäle mit der alliierten Seite aufzubauen, erläutert Tuchel. Bonhoeffer reist dank der Tarnung mehrfach ins neutrale Ausland, etwa in die Schweiz oder nach Schweden - offiziell in geheimdienstlicher Mission. Spätestens da steht er im Zentrum des politischen Widerstands.
Seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Die Kontakte enden bei den alliierten Geheimdiensten, schildert Tuchel. Zu keiner Zeit seien die Widerstandskämpfer von den alliierten Mächten unterstützt worden: „Das ist die Tragik der gesamten deutschen Opposition, nicht nur Bonhoeffers.“
1943 wird er verhaftet und schreibt in der Haft seine theologischen Werke, die erst nach dem Krieg rezipiert werden. Nach seinem Tod entdeckt ihn auch die evangelische Kirche für sich, die in der Mehrheit von 1933 bis 1945 eben keinen Widerstand gegen das Regime leistete.
Offiziell gerät Bonhoeffer nicht etwa wegen seiner Auslandskontakte in Haft, sondern weil er verdächtigt wird, sich dem Wehrdienst entzogen und auch andere darin unterstützt zu haben. Während des Attentatsversuchs auf Hitler am 20. Juli 1944 sitzt Bonhoeffer im Gefängnis. Erst nach dem Auffliegen der Umsturzpläne wird er als Mitglied des Widerstands enttarnt.
Wenige Wochen vor seiner Verhaftung hatte Bonhoeffer sich mit der 18 Jahre jüngeren Maria von Wedemeyer verlobt. Aus seinem letzten überlieferten Brief an sie stammt das wohl berühmteste Gedicht aus seinem Nachlass „Von guten Mächten“.
Im Frühjahr 1945 wird Bonhoeffer erst in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verlegt, dann ins bayerische KZ Flossenbürg transportiert. Kurz vor Kriegsende, die Alliierten sind bereits im Anmarsch, wird er am 9. April 1945 auf Hitlers Befehl hin ermordet. „Hitler wollte, dass von den Verschwörern aus dem Amt Ausland/Abwehr niemand überlebt“, sagt Tuchel. Das Regime habe nicht gewollt, dass diese Menschen an einer Neuordnung Deutschlands mitwirkten.
epd-Nachrichten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie dienen hier ausschließlich der persönlichen Information. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere ihre Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Speicherung in Datenbanken sowie jegliche gewerbliche Nutzung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit Genehmigung der Verkaufsleitung von epd (verkauf@epd.de)